"Wir haben Angst und wir haben keine Angst" – Ein Interview mit Nina Pauer über Selbstdarstellung und die Suche nach Perfektion.
Nina Pauer, 31, schreibt für Die ZEIT. Außerdem ist sie Autorin. Innerhalb von zwei Jahren hat sie zwei Bücher über den Zeitgeist geschrieben – über eine unsichere Generation, eine, die vor lauter Möglichkeiten keine Entscheidungen mehr zu treffen vermag, über die Schwierigkeit, analoges und digitales Dasein zu vereinbaren. Sie beschreibt die Schwierigkeit, all die Fremdbilder zu organisieren und aufrechtzuerhalten, die wir uns in der digitalen Welt aufgebaut haben. Wir, Johanna und Katharina, haben mit ihr für unser Buch über unsere Generation gesprochen.
Katharina: Meine Freunde machen reihenweise Selbstfindungstrips, und generell scheint dieses „Sich-selbst-Finden“ im Trend zu liegen. Dennoch lastet ein unheimlicher Druck auf unserer Generation, dem Selbstverwirklichungsideal gerecht zu werden. Die Angst davor, seine eigenen Ansprüche nicht erfüllen zu können, wird immer größer. Wieso fällt es uns so schwer, das eigene Wesen zu erforschen, und wieso haben wir überhaupt den Drang danach?
Wir sind die Generation, die so viele Möglichkeiten hat wie noch keine zuvor – zumindest bezogen auf die westeuropäische Mittelschicht. In Spanien wäre es natürlich gerade nicht so, und klar, ein ostdeutscher Metallarbeiter, der noch vor 20 mit dem Arbeiten beginnt, ist vermutlich auch in einer anderen Gefühlslage. Ich meine mit meinem Buch immer nur einen Ausschnitt unserer Generation, aber trotzdem ist diese Schicht meiner Meinung nach groß genug, um sie zu beschreiben. Zusammenfassend könnte man sagen: Sobald man sich im Dunstkreis Großstadt oder Uni bewegt, ist das Gefühl der erdrückenden Optionsvielfalt allgegenwärtig.
Katharian: Woher kommt diese Obsession der Selbstverwirklichung denn eigentlich?
Ich glaube, der Drang nach der Selbstfindung ist eine Mischung aus faktischer Optionsvielfalt, dem gesellschaftlichen Ideal des selbst verwirklichten Individuums und dem Bild, das die Medien entwerfen. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Hauptsache, wir sind bei dem, was wir tun, auch wirklich glücklich. Die Ideologie lautet: Finde die perfekte Version deiner selbst! Das löst eine verkrampfte Suche aus, die nur überfordern kann. Es ist dieser Glücksimperativ, an der unsere Zeit krankt. Und dann kommen noch die neuen Kommunikationsmittel dazu – hierbei geht es immer um Selbstinszenierung. Auf einmal arbeitet man auch privat daran, sich selbst immer gut darzustellen. (...) Es ist ja kein Zufall, dass das momentan die beliebtesten Fernsehsendungen sind. Heidi Klum sieht man sich an, damit man noch mal pervertiert vor Augen geführt bekommt, wie furchtbar dieses Selbstoptimierungsprogramm ist, und sich daran ergötzen kann. Gleichzeitig gibt es dann aber auch die andere Seite: Shows wie 'Schwiegertochter gesucht', bei denen Menschen gezeigt werden, auf deren Niveau man keinesfalls selbst sinken möchte: hässlich, dick, einsam, arbeitslos und antriebslos. Dieses Fernsehen dient der Entlastung der eigenen Ängste. Früher ist man für solche Schaukämpfe vermutlich in die Arena gegangen.
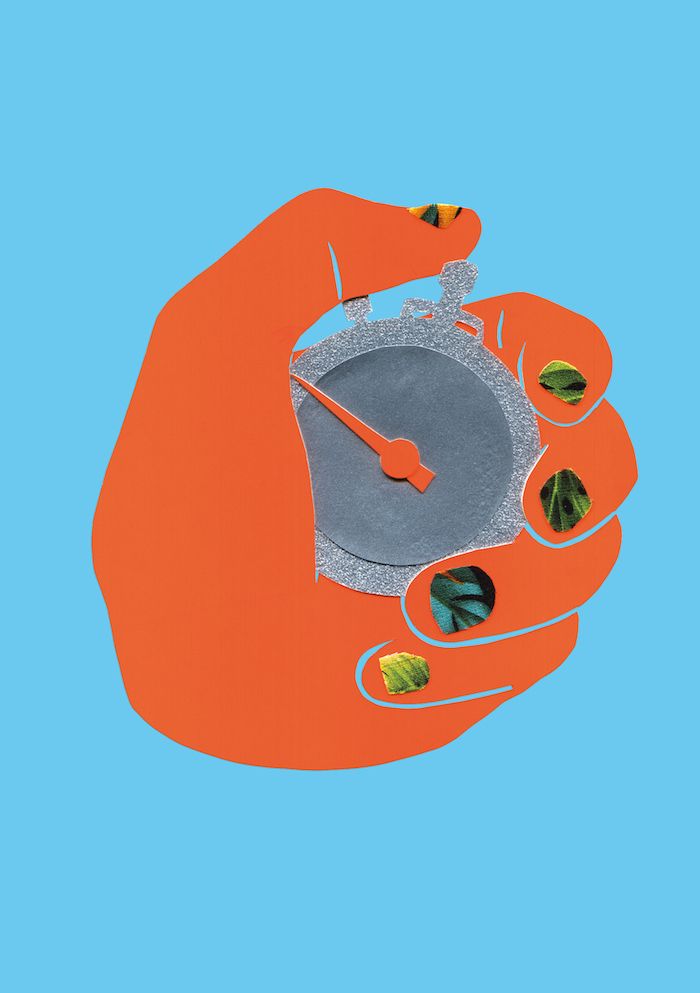
Katharina: Dank der neuartigen Kommunikationskanäle teilen wir uns ständig in lauter verschiedene Ichs auf. Viele Kanäle zu organisieren heißt, in vielen Kanälen ein perfektes Fremdbild aufrechterhalten zu müssen. Dies kann zu Rollenkonflikten führen. Wieso ist es uns aber überhaupt so wichtig, jede Rolle 100-prozentig zu erfüllen?
Ich glaube, hier ist ein urmenschliches Bedürfnis mit uns davongaloppiert. Sich mitteilen zu wollen, das hat man schon immer gemacht. Das Leben zu teilen und einander zu begleiten ist ja eigentlich die Definition von Glück. Durch die technischen Möglichkeiten haben wir uns aber mit so vielen Menschen vernetzt, dass wir süchtig danach geworden sind, uns upzudaten und uns zu vergleichen: Was machen die? Was machen wir? Dann kommt noch der „normale“ Voyeurismus hinzu. Das ist so, als ob man aus dem Fenster schaut und permanent hunderte von Menschen beobachtet: Was machen die alle? Was haben die an? Wieso unterhalten die sich so komisch?
Katharina: Was ist das Neue an der heutigen Kommunikation?
Dass wir alles in einem einzigen Gerät gebündelt haben. Im Smartphone kommt ja alles zusammen: die Jobmails ebenso wie die SMS von einem Freund. Alle Rollen werden also immer gleichzeitig abgerufen, und das meistens noch vor dem Aufstehen! Am Anfang des zweiten Buches beschreibe ich, wie ich als Kind auf die Antwort meines Brieffreundes gewartet habe. Es war einfach nur aufregend zu wissen: Er ist dran mit Schreiben, bald kommt ein Brief. Ich glaube, diese Aufregung, dieser positive Stress, ist ein Urinstinkt. Heute sind es eben die roten Bläschen auf meinem iPhone, im Endeffekt ist es aber dasselbe geblieben: „Nina,
es ist Post für dich da!“ bedeutet das Signal. Allein die Kraft des eigenen Namens hat diesen Sog, sofort zu reagieren. Es gibt ja inzwischen die ersten Forschungen, die untersuchen, was für Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man soziale Resonanz in Form von ständigen Benachrichtigungen erfährt. Im Grunde bedeutet ja dieses Dauerkommunizieren: Ich bin ein aktiver Teil der Gesellschaft, ich hab ganz viele Freunde und mindestens die siebte von zehn E-Mails wird eine schöne sein. Dadurch, dass man flatratemäßig kommuniziert, kann man sich gegenseitig ja auch viel leichter und öfter sagen, dass man aneinander denkt. Gerade vor der Kulisse dieser hyperkomplexen, total schnellen, kalten Castingshow-Welt, in der wir leben, ist genau das eben so viel wichtiger geworden. Vor allem in Zeiten mit horrenden Scheidungsraten wird Freundschaft immer wichtiger.
Johanna: Du beschreibst uns als angstbefreite und gleichzeitig angstbesessene Generation. Wie spielt das zusammen?
Das war die Ausgangslage zum ersten Buch: Auf dem Titel ist quer über dem Schriftzug ein Aufkleber platziert: „Wir haben Angst“ wird zu „Wir haben keine Angst“ – und beide Botschaften stimmen. Ich beschreibe im Buch zunächst die auffällige Angstbefreitheit unserer Kindheit und Jugend. Es waren immer nur die Medien und unsere Eltern, die die Welt untergehen haben sehen: Tschernobyl, BSE, das Internet – immer war es kurz vor zwölf. Nur, wir konnten die Angst nicht teilen, denn am Ende ist uns ja nie etwas passiert. Dazu kommt noch die Geschichte: Wir selbst haben keinen Krieg erlebt, das war eine „Opa-Generations-Sache“. Und ansonsten passierte und passiert alles Schlimme ja immer irgendwo anders auf der Welt, nur nie vor der eigenen Haustür. Das macht es schwer, sich mit den Bedrohungen auseinanderzusetzen, und wir schämen uns auch dafür, dass wir globale Themen nie so wirklich an uns ranlassen konnten. Wir konnten uns nie wirklich ernsthaft fürchten.
Johanna: Wieso haben wir trotzdem Angst?
Die Angst, die wir im Großen, Globalen, nie hatten, kommt bei uns im Individuellen dabei umso stärker heraus: Wir sagen permanent, dass uns alles zu viel wird, dass wir mal runterkommen müssten, ... Wir rennen massenweise in Therapien, haben erstaunlich früh gesundheitliche Probbleme, wie Bandscheibenvorfälle oder chronische Blasenentzündungen, noch bevor wir 30 Jahre alt sind. Das sind alles Phänomene, die für einen starken psychischen Druck sprechen, von einer Angst, von einer Furcht. Diese Schizophrenie von Angstbefreitheit und Angst hat mich so fasziniert: Nach außen hin wirken wir ja super, sind offen, lässig, bescheiden, ironisch, gebildet, fit. Und wir verstehen uns gut mit unseren Eltern. Was will man eigentlich mehr! Und gleichzeitig, im Inneren, bezweifeln wir alles.

Katharina: „Wir haben keine Angst“ – eigentlich. Doch wenn man hinter die Fassade blickt, haben wir sehr wohl Angst – zum Beispiel hinter eigenen Statements zu stehen. Im Web werden jeden Tag zuhauf Facebook-Status, Twitter-Meldungen oder Online-Artikel unverfroren und manchmal auch gemein kommentiert und kritisiert. So kann schnell eine Versagensangst beziehungsweise Kritikpanik entstehen. Gepostet werden im Endeffekt nur Oberflächlichkeiten, Orte, Momente, selten hingegen Statements oder echte Anliegen. Fällt es uns einfach nur schwer, eine eigene Meinung zu bilden, oder ist es die Angst, diese öffentlich zu vertreten?
Wir haben totale Angst davor, uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Im Buch nenne ich das die „Pathos-Allergie“. Hauptsache, man wirkt nicht zu emotional, zu unironisch, zu peinlich, oder „desperate“, also zu offensichtlich auf der Suche nach Anschluss oder Anerkennung. Scham und Peinlichkeit gab es ja schon immer, aber wir leben in einer Zeit, in der unser Sicherheitsbedürfnis, scheinbar immer lässig über den Dingen stehen zu müssen, dazu geführt hat, lieber immer nur Nein und nur sehr schwer Ja zu etwas zu sagen. Man lebt nach dem Ausschlussprinzip: Diese Partei ist Mist, diese Politiker sind lächerlich, der Stil geht gar nicht. Es scheint schwer für uns zu sein, für etwas Bestimmtes zu stehen, an etwas Bestimmtes zu glauben. Sich hinzustellen und „Hört alle zu, das ist es, was ich liebe, was ich mir wünsche, woran ich glaube und wofür ich einstehe“ zu sagen, das kann kaum noch jemand.
Katharina: Was sind die Folgen dieser Hemmung, ein Statement abzugeben?
Mit Ironie kriegt man zum Beispiel keine wahre Liebe. Die besteht ja gerade aus Verletzlichkeit, eben weil man sich aus dem Fenster lehnt, ist das Gefühl so groß. Auch politisch oder religiös zu sein besteht darin, sich auf diese Art und Weise angreifbar zu machen. (...)
Katharina: Ich weiß, was mein Kindergartenfreund gefrühstückt, wo meine Grundschulfreundin dieses Jahr ihren Urlaub verbracht hat, und ich kenne die Ultraschallbilder des ungeborenen Kindes einer Bekannten! All das dank Facebook. Wieso boomen gerade in unserer Generation die sozialen Netzwerke? Warum interessieren uns diese vielen überflüssigen Informationen überhaupt?
Voyeurismus. Man klickt sich da ja durch Urlaubsfotos von irgendwelchen Leuten, die man schon in der Schule nicht kannte, und fragt sich irgendwann, wo man da eigentlich gelandet ist. Vermutlich ist es auch der Wunsch, sich zu vergleichen. Ich habe mal von einer Studie gelesen, die besagt, dass Menschen mit mehr als 200 Facebook-Freunden unglücklich werden. Du siehst da einfach zu viele Leben, und alle stellen sich so wahnsinnig positiv dar. Da fragt man sich doch sofort, ob man im Vergleich zu denen vielleicht zu normal, zu langweilig ist. Ein anderer Grund für den Erfolg von Facebook ist, dass dort auch Jobs und Veranstaltungen durchgegeben werden. Man will nichts davon verpassen. Der super individualisierte Mensch hat ja immer Angst, nicht mitzukommen, und es gibt auch die Angst vor sozialem Abstieg: Nur weil man als Mittelschichtkind geboren ist, heißt das noch lange nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Man muss immer gucken, was los ist, was andere tun, wie man weiterkommt.
Katharina: Ein Streichholz: aufreißen, anzünden, abbrennen, aus- glühen, wegschmeißen ... So schnell, wie unsere Interessen geweckt werden, verfliegen sie auch wieder. Wie kannst du dir dieses Phänomen erklären?
Wahrscheinlich ist es auch hier die Suche nach den 100 Prozent, der Perfektion. Das Liebeskapitel in meinem Buch, aus dem das Bild mit dem Streichholz kommt, ist nicht aus Zufall das sehnsuchtsvollste. Die Basis für Liebe ist heute nur noch Romantik, pure Romantik. Man kann sich ja, moralisch und meist ökonomisch gesehen, sofort trennen, sobald es nicht mehr gut läuft. Da macht einem niemand einen Vorwurf so wie früher. Wenn die Liebe wirklich da ist, wenn man meint, die wahre Liebe gefunden zu haben, dann wird das ganze „Paket Romantik“ auf eine einzelne Person projiziert. Sobald es da um Verantwortung und Normalität geht, kann die Sache schnell wieder vorbei sein. Das enttäuscht uns natürlich. Aber gleichzeitig zeigt es ja nur, wie groß der Wunsch danach ist, endlich anzukommen, und wie groß die Angst ist, dass es vielleicht nicht klappen könnte – so groß nämlich, dass man lieber alles wieder zurücknimmt und doch weitergeht.

Diese Interview-Auszüge stammen aus dem Buch „Maybe you should go fuck yourself“, einem Projekt von Johanna Dreyer und Katharina Weiß. Das Buch enthält auf etwa 300 Seiten eigens verfasste Texte, Essays von Außenstehenden, Interviews, Fotografien, Illustrationen und Infografiken. Mit dabei sind u.a. auch Jan Böhmermann, Christopher Lauer oder Prof. Dr. Klaus Hurrelmann sowie Essays von Silke Burmester und Johanna Maria Knothe.



